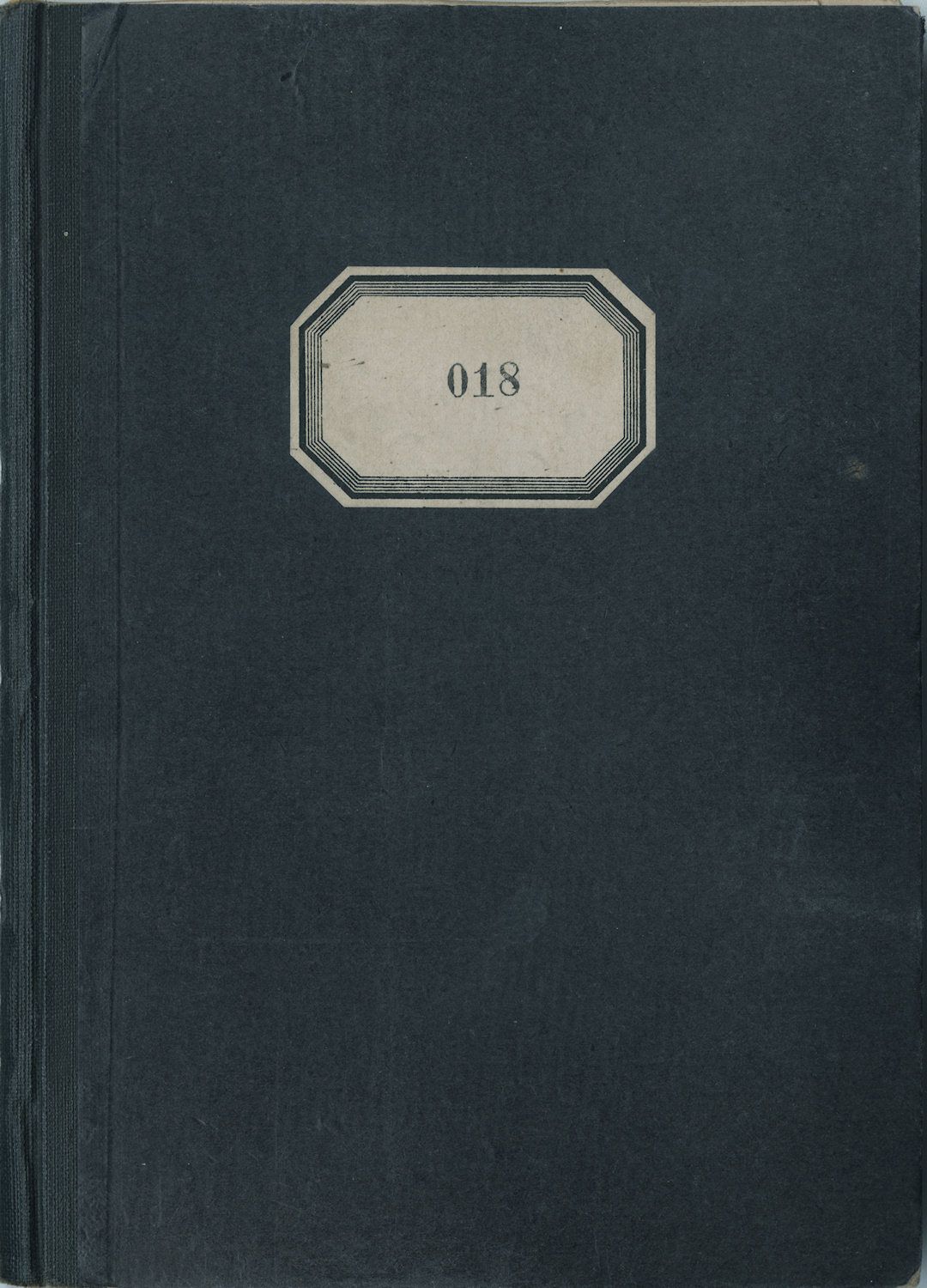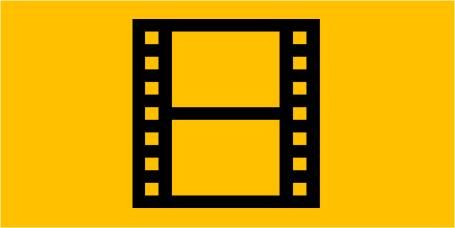1919 Einsatz (Seite Kompaktus)
1919 Einsatz
Stelentext 1919 Einsatz
[111] Bei der Mobilmachung 1914 stehen der Armee sieben Telegraphen-Pionierkompagnien und eine Signal-Pionierkompagnie zur Verfügung. Lediglich drei der sieben Telegraphen-Pionierkompagnien sind mit neuerem Material ausgerüstet. Bereits 1916 müssen weitere sieben Kompagnien für die vier Gebirgsbrigaden aufgestellt werden. Der Mangel an Truppenstärke und Material bleibt jedoch bestehen.
1914 wird in der Telegraphenkompagnie 7 erstmal ein Funkenzug gebildet. 1917 erfolgt die Aufstellung einer Funken-Pionierkompagnie. Der zivil orientierte Ausbau des Leitungsnetzes stärkt die Bedeutung des Funks und führt 1924 zur Bildung der Funker-Abteilung mit Verbindungen bis zur Infanterie- und Artilleriebrigade. Die Boden-Luftverbindungen der seit 1914 aufgebauten Fliegertruppe gewährleistet der Funkerdienst der Fliegerabteilung.
Die Stelen beschreiben Einsatz und Truppen zur Uebermittlung von der Truppenordnung 1910 bis zur Armeeorganisation von 1995. Texte (Kapitel) bei und an den Podesten fokussieren auf die (bereits) in grosser Zahl eingesetzten Geräte. 1919 basiert auf den Truppenordnungen von 1910 und 1924: Telegrafieren, Telefonieren, Signalisieren unterstützen die Führung.
SIGNALISIEREN, MORSEN 1
Kapiteltext
[112] Der optische Signaldienst ergänzt den Telegrafen
Die Schwierigkeit des Baus von Telegrafenlinien in nützlicher Frist führt nach 1875 zur Einführung der ersten Feld-Signalapparate. Erst der Wechsel zum Morsesystem 1897 ermöglicht eine genügende Übermittlungsleistung.
Der Signaldienst ergänzt den Telegrafen. Infanterie und Artillerie signalisieren mit Flaggen und Winkerzeichen. "Mit Rücksicht auf die geringe Leistungsfähigkeit (2 Worte pro Minute) müssen alle Depeschen mit möglichster Kürze abgefasst werden" (Signaldienst 1905).
1922 werden aus Liquidationsbeständen des kaiserlich-deutschen Heeres 900 Signalgeräte mit einer Metallfadenlampe, Kurbelgenerator, verlustarmer Optik und 9 km Reichweite beschafft und in der Folge in Lizenz gebaut. Sie revolutionieren den optischen Signaldienst und bleiben bis zu dessen Auflösung 1947 im Einsatz.
weiter zu Kapitel "funken (morsen)"
Telegrafieren, Morsen 2
Kapiteltext
[113] Die Armee nutzt und erweitert das Telegrafennetz
Der 1873 eingeführte Morseschreiber ermöglicht den Anschluss von Kommandposten an das seit 1852 aufgebaute eidgenössische Telegrafennetz. Die Armee verfügt 1913 über die benötigten zivilen "Linien, Bureaux, Apparate und Materialien".
Die Ausrüstung mit Kabelbauwagen, Feldkabel und Gefechtsdraht ist bei der Mobilmachung 1914 unvollständig. Bis 1917 werden 3500 Stangen, 35'000 Isolatoren und 50'000 kg Draht in die Ergänzung des Zvilnetzes verbaut. Zur Mehrfachnutzung werden "Duplexschaltungen" (Cailho) eingesetzt.
Der bis 1918 auch im Armeekommando verwendete Typendrucktelegraph Hughes ist nicht feldtauglich. Erst der 1935 beschaffte Schreibtelegraf (Streifenschreiber) löst den Morseschreiber ab. Handstanzer und Lochstreifensender ermöglichen die Nutzung der vollen Übertragungsleistung.
weiter zu Kapitel "signalisieren (morsen)"
Telefonieren 1 (Apparate)
Kapiteltext
[114] Vorposten und Beobachter nutzen die ersten Telefone
Nach Versuchen seit 1888 wird 1910 von Infanterie und Artillerie Telefonmaterial für Patrouille und Beobachtung gefordert. Mit Lauthörtaste, Kurbelinduktor und Anrufsummer erfolgen Verbesserungen. Die Stromversorgung aus einer "Lokalbatterie" und die Anschlussfähigkeit an das Zivilnetz setzen sich durch. 1911 verfügen die Telegraphen-Pionierkompagnien zusammen über 180 Telefone in 3 Modellen.
Zwischen 1933 und 1944 werden 11'000 Stück des "Armeetelephons 32" mit Holzkasten und einem Wählerzusatz für das zunehmend automatisierte Zivilnetz beschafft. Das "Feldtelefon 41" im Ledertornister bringt Sprechtaste und Leitungsprüftaste.
Das "Feldtelefon 50" für den Einsatz im Gelände und das "Armeetelefon 53" für den Stabsbetrieb (beide mit Wählerzusatz) wurden für fast 50 Jahre "das Armeetelefon".
weiter zu Kapitel "telefonieren (Zentralen)"
Chiffrieren 1
Kapiteltext
[117] Der Feind hört mit - die Kodierung der Funksprüche
Die Schwierigkeit des Baus von Telegrafenlinien in nützlicher Frist führt nach 1875 zur Einführung der ersten Feld-Signalapparate. Erst der Wechsel zum Morsesystem 1897 ermöglicht eine genügende Übermittlungsleistung.
Der Signaldienst ergänzt den Telegrafen. Infanterie und Artillerie signalisieren mit Flaggen und Winkerzeichen. "Mit Rücksicht auf die geringe Leistungsfähigkeit (2 Worte pro Minute) müssen alle Depeschen mit möglichster Kürze abgefasst werden" (Signaldienst 1905).
1922 werden aus Liquidationsbeständen des kaiserlich-deutschen Heeres 900 Signalgeräte mit einer Metallfadenlampe, Kurbelgenerator, verlustarmer Optik und 9 km Reichweite beschafft und in der Folge in Lizenz gebaut. Sie revolutionieren den optischen Signaldienst und bleiben bis zu dessen Auflösung 1947 im Einsatz.